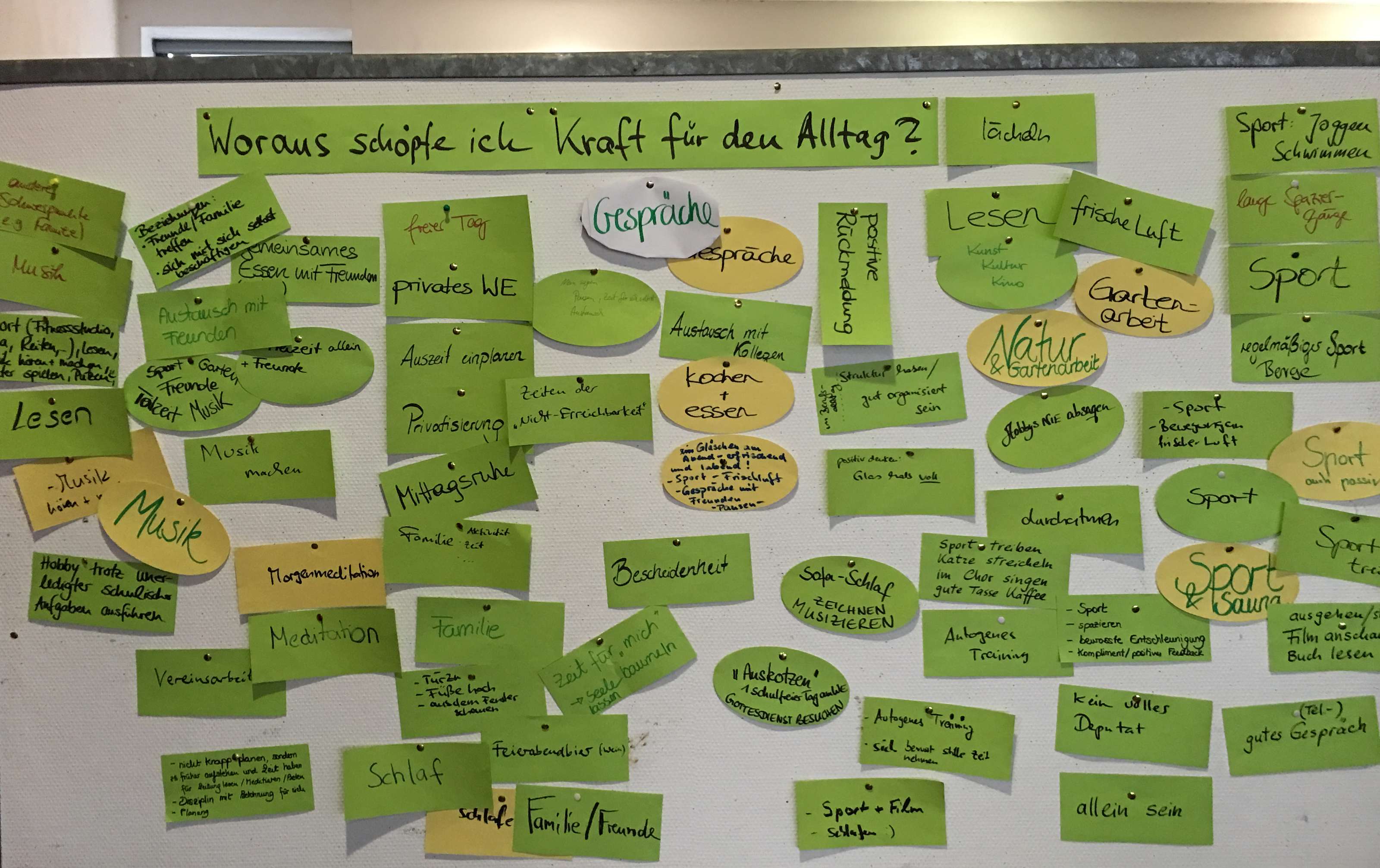Das Bergische Internat
Die Villa Wewersbusch ist eine private Ergänzungsschule mit insgesamt ca. 200 Schülerinnen und Schülern (davon 90 im hauseigenen Internat), die 850,- und mehr im Monat als Schulgeld bezahlen. Die Abschlussprüfungen werden zwar in Klasse 10 und 13 auch von Externen abgenommen, weshalb auch Inhalte und Kompetenzen der staatlichen Bildungspläne vermitteln müssen, dennoch ist die Schule relativ frei in der Ausgestaltung der Jahre bis dahin. Diese Voraussetzungen werden radikal genutzt.
Vorstellung von Bildung und Lernen
Ziel ist es, die Schülerinnen und Schüler nicht zu Personen werden zu lassen, die sinnentleerte Inhalte der Bildungspläne aufnehmen und reproduzieren sollen. Im Gegenteil: Sie sollen zu Produzenten Ihrer eigenen Lerninhalte werden über:
- Recherchieren
- Produzieren
- Präsentieren
Ein Bild wurde gleich zu Beginn der Hospitation bemüht: Wenn man die meistgesuchten Begriffe in einem Business-Netzwerk wie LinkedIn und die staatlichen Bildungspläne übereinanderlege, so fänden sich kaum Parallelen. Dies gelte es zu ändern.
Weg vom traditionellen LehrerInnenbild
Als Kontrastfolie für die eigene Zielsetzung beim Lehren dient ein Lehrerbild, in dem eine veränderungsresistente Lehrperson die immer gleichen, wenig sinnstiftenden Inhalte eines zentral vorgegebenen Bildungsplanes vermittelt, die die Schüler und Schülerinnen dabei zu Tode langweilt und am Ende auch dadurch wenig nachhaltige Kompetenzen schafft.
Weg mit den Lehrwerken
Um diese Situation zu erreichen, müssen die traditionellen Formen der Wissensvermittlung gehen: Es gibt z. T. keine zentrale Projektionsfläche mehr (es gibt sie zwar, aber sie ist flexibel im Raum oder an der Seite angebracht, damit es kein „Vorne“ mehr gibt). Weiterhin werden ab dem kommenden Schuljahr die letzten eingeführten Lehrwerke von Verlagen abgeschafft. Input wird von den Lehrenden und Lernenden selbst kreiert, und zwar auf den individuell bezahlten und verwalteten iPads der Schülerinnen und Schüler.
Organisiert wird dieser Prozess in iTunesU-Kursen, die quasi als „Hub“ bzw. Sammlung für die erstellten Lernmaterialien bzw. eher Produkte genutzt werden. Oftmals gibt es kurze Inputphasen durch Lehrerinnen und Lehrer und anschließend eine neigungsspezifische Differenzierung, an deren Ende immer ein Produkt steht.
Inhaltsschaffende Apps
Wer dem App-Wahn verfallen ist, findet an dieser Schule zunächst keine Unterstützung. Das Mantra lautet: Man benötigt hauptsächlich „inhaltsschaffende“ Apps. Es werden kaum fachspezifische Apps genutzt. Dann reichen auch einmal 3 verschiedene Grundlagen-Apps für das erste Jahr, so z. B. BookCreator (für Lesetagebücher uvm.), ein Mind-Mapping Programm und Kahoot (für selbst erstellte Quizzes) sowie natürlich die Standard-Office-Anwendungen (hier die Versionen von Apple wegen der iPads).
Medienkompetenz
Interessant ist, dass erst für das 5. Jahr des Bestehens der Schule an diesem Standort, also im 5. Jahr mit iPads, ein systematisches Mediencurriculum erstellt wird. Das zeigt aber lediglich, dass man mit der Technik zunächst seine Erfahrungen sammeln musste, und die Vermeidung der Fehler der Vergangenheit galt es dann anschließend zu systematisieren. Was ebenfalls in diesen Bereich gehört: Die Internatsschüler vor Ort müssen ihre iPads nach der Schule abgeben, alle Schülerinnen und Schüler während der Stunden auch die Handys und die Internatsschüler auch abends. „Die sollen sich ohne Technik zu beschäftigen wissen: Sport, Spiel, Gespräche, Unternehmungen in der Natur. Es gibt hier keine Playstation und der Fernseher wird kaum genutzt.“
Die Rolle des Papiers
Einige Gedanken zum Thema Papier: Man wird es bei digitaler Arbeit nicht durchgängig los. Das hat einige gute Gründe. Zunächst ist es schwierig, einen Text auf dem iPad zu lesen und gleichzeitig „Content“ zu produzieren. Für den Splitscreen-Modus sind die iPads zu klein. So kommt es wohl immer wieder zu Mischformen zwischen analog und digital. Zum anderen geht auf kleinem Bildschirm auch mal der Überblick verloren, der auf einem A2-Plakat in ganz anderer Qualität entstehen kann.
Der Unterricht – was verändert sich durch die Technik?
Es ist schwer, nach einem Vormittag in den Klassen 5-9 ein abschließendes Urteil über die Frage zu fällen, inwiefern sich der Unterricht überhaupt verändert oder im Einzelnen verbessert oder sogar verschlechtert. Was uns mitgeteilt wurde, war, dass der Oberstufenunterricht – den wir leider nicht zu sehen bekamen – noch etwas „klassischer“ abliefe, da ja auf ein wissensbezogenes Abitur vorbereitet werden müsse. Diesen Gedanken lohnt es allerdings aufzugreifen, denn das Gymnasium hat ja als Schulform insgesamt das Problem, etwas mehr gedankliche (auch theoretische) Tiefe erreichen zu müssen, so wie es an der Villa Wewersbusch in der Oberstufe dann auch benötigt wird, um das Abitur bestehen zu können und vielleicht auch, um durch die entsprechende Vertiefung eine Form der Allgemeinbildung zu erreichen, die den Lernenden Transfer und Kreativität in einer komplexer werdenden Welt erst ermöglichst.
Was wir beobachtet haben, war durch die Bank normaler Unterricht, unterstützt mit Tablets. Wer schon die Arbeit an Schulpreis-Schulen zu sehen bekommen hat, weiß, dass Projektunterricht und Produktorientierung sich an guten Schulen weitestgehend durchgesetzt haben, dass dezentrales Arbeiten mit bestimmen Phasen der Zentralisierung absoluter Standard geworden sind, dass Neigungsdifferenzierung ebenso wie die leistungsspezifische Differenzierung dort praktiziert werden, dass das Raumkonzept diese Art des Arbeitens dann auch widerspiegelt (durch viele Sitzecken im öffentlichen Raum, Nischen etc.). Das alles macht nicht die Technik möglich. Der Vorteil der Nutzung von Technik liegt in der schnelleren Erfassung von Leistungsständen (Diagnose) und der Möglichkeit, darauf zügig zu reagieren. Wenn man Apple und Google glauben möchte, liegt ja die Zukunft darin, dass später einmal Algorithmen automatisch den Lernenden Aufgaben zuweisen, die ihren jeweiligen Leistungsständen entsprechen. Die Diagnosetools werden in Ansätzen bereits genutzt.
Die Leitfrage für den Unterricht, die wir uns stellten, war, ob die fast durchgehende Arbeit mit Technik dazu führt, dass die Schülerinnen und Schüler vereinzeln oder ob die Kollaboration durch das gemeinsame Erarbeiten von Produkten gefördert wird – was unsere Hoffnung war. Ebendiese Hoffnung hat sich in der Hospitation nur teilweise bestätigt, zum Beispiel, wenn in Klasse 5 mehrere Filmteams Videos über das Thema „Brüche“ in Mathematik entstehen ließen, indem sie eine Waffel mehrfach aufteilten und so u.a. das Prinzip des kleinsten gemeinsamen Nenners erklären konnten.
Auch Gegenteiliges ließ sich beobachten: Gamification hat den Reiz, Schülerinnen und Schüler z. B. über den Wettbewerb eines Quiz zum Lernen von zu Reproduktionswissen zu bewegen. Gleichzeitig besteht in einem solchen Ellbogen-Klima auch etwas die Gefahr, den Respekt vor dem Anderen vermissen zu lassen. Richtig ist sicherlich, dass wir Schülerinnen und Schüler auf das Leben nach der Schule vorbereiten müssen, und da erwartet sie auf dem Arbeitsmarkt als Arbeitnehmer oder auch als Unternehmer der Wettbewerb. Richtig ist auch, dass wir unbedingt Elemente davon in der Schule einsetzen sollten. Genauso wichtig ist jedoch auch das Klima in einem Team, wenn gute Ergebnisse erreicht werden sollen. Die kritische Wertschätzung der Produkte Anderer – durch Lehrende und Lernende – war nur vereinzelt vorhanden.
Spielen die nur im Unterricht?
Spiele-Apps sind in der Villa Wewersbusch verboten. Wenn jemand erwischt wird, werden die iPads der gesamten Klasse gefilzt, erzählte ein Schüler der 7. Klasse. Gegebenenfalls wird auch mal der App-Store gesperrt (was eine schlimme Strafe zu sein scheint). Im übrigen werden Schülerinnen und Schüler durchaus zügig der Schule verwiesen, um den anderen deutlich zu machen, dass sie sich an die Regeln zu halten haben. Dafür reicht es schon, 2x im Pausenhof zu rauchen.
Haben wir nun Lernende beobachtet, die permanent zockten, während andere Arbeitsergebnisse präsentierten? Ein klares „Nein“ – allen sind die Regeln klar, dazu gehört eben auch, dass das eigene iPad aus ist, wenn jemand Anderes präsentiert. In der Mittelstufe ist das abweichende Verhalten dann genauso präsent wie an allen anderen Schulen auch: Da zockt schonmal die gesamte letzte Reihe Ego-Shooter, während vorne eine Schülerin ihre Keynote-Präsentation über ein emotionales und bedeutsames Thema zeigt. Wir wissen, dass in diesem Alter in den Köpfen der letzten Reihe aber überall in Deutschland andere Themen wichtiger sind als ebendiese Präsentation vorn.
Werden die Ziele des Unterrichts erreicht?
Was sind die Ziele des Unterrichts? Wir würden den Protagonisten vor Ort jederzeit zustimmen, dass der heimliche Lehrplan (auch wenn das Wort vor Ort nicht fiel) eigentlich ein ganz anderer ist, als der Bildungsplan vorgibt. Neben der viel zu kurz kommenden Frage der zweiseitig verstandenen Medienkompetenz („Ich beherrsche die Medien, nicht die Medien mich“) sicherlich auch die intensive Förderung der Key Skills des 21. Jahrhunderts: Kreativität, Kollaboration, aber auch kritische Recherche. Hier beweist die Villa Wewersbusch einfach den Mut, sich auf den Weg zu machen und manche, heutzutage einfach unsinnig erscheinende, Inhalte dabei wegzulassen, was ein konsequenter Schritt ist.
Gleichzeitig haben Gymnasien auch noch den Anspruch, kategoriales, z. T. theoriegetriebenes, verknüpfendes Denken zu fördern, mit dem Ziel, zu einem Erkenntnisgewinn zu kommen. Dass es dabei mit den Strukturen des 19. Jahrhunderts heutzutage nicht mehr auskommt, ist inzwischen jedem, der an Schulentwicklung interessiert ist, klar. Aus dieser Sicht heraus konnten wir an der Villa Wewersbusch sehen, dass dort sehr viel Zeit in das Lernen von Methoden investiert wird, man könnte auch flapsig sagen: inhaltlich kommt weniger dabei rum. Für die Villa Wewersbusch ist dies sicherlich eine logische Folge ihres Ansatzes des „Weniger ist mehr“ und damit durchaus gewollt. Das Gymnasium verfolgt einen höheren inhaltlichen Anspruch, um einen bestimmten Durchdringungsgrad zu erreichen, der mir später neue, eigenständige Denkansätze ermöglicht. Wie gehen wir mit diesem Dilemma um? Und lassen sich komplexe Sachverhalte methodisch ebenso produktorientiert im Unterricht umsetzen? Vermutlich ja (siehe Explainity-Videos uvm.), aber wir haben dort ein spannendes neues Arbeitsfeld, das über die Arbeit an der Villa Wewersbusch hinaus geht.
Fragen als kritischer Freund
- Der Gedanke, einen Hub für alle Lernmaterialien zu haben (wie es z. B. die beiden digitalen Notizbücher OneNote bzw. Evernote bieten), ist noch nicht klar definiert. Ordnerstrukturen (wie auf dem klassischen Computer) sind sicherlich nicht die Form, unser Wissen und unseren „Content“ in der modernen Gesellschaft und damit auch in der modernen Schule zu strukturieren, aber ein Speicherort einfach irgendwo auf dem Gerät ist auch nicht die Antwort (auch wenn die Suchfunktion gut ist), vor allem dann nicht, wenn ich aus bereits erarbeiteten Wissensgebieten Neues schaffen will bzw. dazwischen Verknüpfungen entstehen sollen. Hier sehe ich für das Arbeiten am Gymnasium noch weiteren Bedarf nachzudenken.
- Die (zum Schulkonzept passende radikale) Reflexion über die Technikorientierung wird momentan noch abgelehnt. Diese wäre z. B. durch eine medienfreie Woche denkbar (auch ohne Bücher etc.), um zu erfahren, inwiefern Medien auch mein Leben bestimmen. Medienkompetenz ist hier m. E. noch nicht in aller Konsequenz zuende gedacht, wenn man das Ziel hat, Schülerinnen und Schüler zu einem selbstbestimmten Leben zu führen. Gerade einer Schule, die stark auf die technische Dimension setzt, würde diese Methode der „digitalen Diät“, die viele Technik-Geeks nutzen, gut zu Gesicht stehen. Lernen, gerade im Bereich der Persönlichkeitsbildung und dem sozialen Miteinander, findet ja in der Face-to-Face Interaktion mit Anderen statt.
- Einer Einordnung der eigenen pädagogischen (!) Arbeit wollen sich die Protagonisten der Schule zunächst entziehen. Es lassen sich viele Ansätze der Reformpädagogik erkennen, u. a. auch das aufgabenorientierte Lernen (Task-based Learning), eine Diskussion über diese Einbettung wurde jedoch tendenziell abgelehnt. Die Vermutung ist hier, dass die Abgrenzung zu traditionellen Methoden der Vermittlung zum Konzept der Außendarstellung gehören. Lieber orientiert man sich bei Inhalten, Methoden und Raumgestaltung an den Großraumbüros (bzw. eher kreativen Spielwiesen) von Unternehmen wie Apple und Google, deren Arbeitsplätze geprägt sind von variablen Sitzmöbeln, differenzierter Lichtgestaltung und insgesamt so angenehmem Ambiente.
Fazit
Alles in allem war diese Hospitation, für deren Ermöglichung wir sehr dankbar sind, vielleicht ein Blick in die Zukunft des Lernens, vielleicht ein Blick in ein Labor, dem viel probiert wird und in dem zunächst „alle Fehler gemacht“ werden, so der Geschäftsführer Florian Kesseler, um zeitgemäßen Formen des Lernens näher zu kommen. Wir lernen gerne mit und versuchen, mache Fehler bei der Umsetzung unserer aktuellen Lerndesigns zu vermeiden.